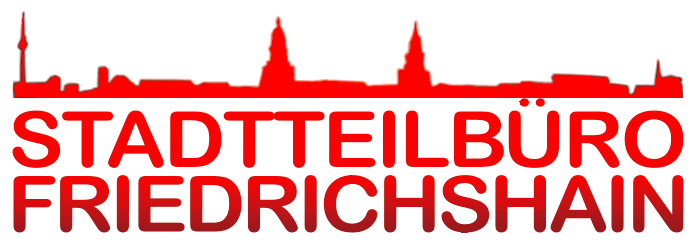Die Koalition aus Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen stehe für eine neue Beteiligungskultur, heißt es in der Präambel ihrer Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 2016. In den Richtlinien der Regierungspolitik wird im Abschnitt „Gutes Regieren und neue Beteiligungskultur“ außerdem die Aufstellung von Leitlinien angekündigt. Im bundesweiten Vergleich ist Berlin damit spät dran: Seit 2012 haben viele Städte in Deutschland Leitlinien für Bürger*innen-Beteiligung eingeführt. Meistens wurden sie wie in Berlin unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft erarbeitet.
Die „Leitlinien für die Beteiligung der Bürger*innen an Projekten und Prozessen der räumlichen Stadtentwicklung“ wurden im September 2019 vom Berliner Senat beschlossen beschlossen. Bis Mitte 2020 soll ein Umsetzungskonzept für die Leitlinien erarbeitet werden, und zwar unter Einbezug aller „planenden und bauenden Dienststellen der Bezirke und des Landes“ (s. VzK des Senats, AGH Berlin, S. 7-9). Aber warum braucht es überhaupt Leitlinien für die Beteiligung an der Stadtentwicklung?
Gesetzlich geregelte Bürger*innen-Beteiligung
Die Beteiligung von Bürger*innen an der Stadtentwicklung, konkret für die Bauleitplanung, ist im Bundesrecht geregelt, und zwar im Baugesetzbuch (§ 3 BauGB). Dort heißt es, dass die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die Bauleitplanung zu unterrichten ist. Außerdem ist ihr „Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung“ zu geben. Anschließend müssen die Entwürfe der Bauleitplanung für mindestens 30 Tage an einer öffentlichen Stelle ausgelegt werden und interessierte Bürger*innen können dazu Stellungnahmen abgeben.
In der Praxis bedeutet das häufig, dass auf der Website des zuständigen Bezirksamts oder in einer Berliner Tageszeitung per Anzeige darüber informiert wird, wo und wie lange die Entwürfe im zuständigen Bürgeramt ausliegen. Da müssen interessierte Bürger*innen schon genau wissen, was und wo sie suchen müssen. Auch wie die „Gelegenheit zu Äußerung und Erörterung“ der Planung genau gestaltet wird, ist nicht geregelt und wird also von Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune unterschiedlich umgesetzt. Im Zweifelsfall genügt der gesetzlichen Regelung die öffentliche Bekanntmachung in einer Tageszeitung darüber, dass sich die Bürger*innen gerne zu einer Planung äußern können. Eine solche Handhabung von Beteiligung erfordert aber einiges Vorwissen und viel Eigeninitiative von Menschen, die sich an einen Planverfahren beteiligen wollen, denn das Recht, sich an der Bauleitplanung zu beteiligen, gehört leider nicht zum Schulstoff.
„Informelle“ Beteiligungsprozesse
Andererseits geht Beteiligung schon seit vielen Jahren über das hinaus, was gesetzlich als Auslegung und Unterrichtung über ein Vorhaben geregelt ist. Aber auch in Berlin gab es bisher keine einheitlichen Standards oder Formate für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Stadtentwicklung. Letztlich liegt es dann im Ermessen der zuständigen Behörde, Senator*in oder Stadträtin, wie weit Beteiligung geht und welche Formen sie annimmt: Info- oder Diskussionsveranstaltungen, Befragungen, Dialogwerkstätten, ein Bürger*innen-Haushalt uvm.
Stadtbewohner*innen wollen mitreden, wenn es um die Entwicklung ihrer Lebensräume geht und oft findet ein Beteiligungsverfahren zu einem Vorhaben erst auf Initiative engagierter Anwohner*innen statt. Oder soziokulturelle Vereine setzen sich gemeinsam mit ihren Nachbar*innen für eine stadtteil-orientierte Entwicklung ein. Für diese (oft selbstorganisierten) Beteiligungsprozesse gibt es aber
- keine rechtlich verbindliche Grundlage und manchmal laufen sie regelrecht parallel zu den formalen Planverfahren, ohne dass ihre Ergebnisse Niederschlag in der Planung finden. Sie werden deshalb in der Regel als informell bezeichnet. Die Geschichte des RAW-Geländes in Friedrichshain seit 1998 ist ein gutes Beispiel für dieses Nebeneinander von formaler Planung und informellen Beteiligungsprozessen.
- ungleiche Voraussetzungen und keinen niedrigschwelligen Zugang zu Kenntnissen: nicht nur zu Möglichkeiten der Bürger*innen-Beteiligung oder direktdemokratischen Instrumenten (z. B. der Einwohner*innen-Antrag), auch Kenntnisse der baurechtlichen Grundlagen. Oder zu den richtigen Ansprechpartner*innen in Politik und Verwaltung, oder ob es eine finanzielle Förderung von selbstorganisierter Beteiligung gibt (z. B. Raummiete für eine Nachbarschaftsversammlung). All das hängt bisher davon ab, wie viel Zeit interessierte Stadtbewohner*innen in die Recherche und Kontaktaufnahme stecken können.
Nachbarschaftswissen als „Ressource“ für den Planungsprozess
Aber auch die Haltung von Politiker*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen zu Bürger*innen-Beteiligung verändert sich. Dabei reagieren sie nicht allein auf den Wunsch oder die Forderung der Stadtbewohner*innen, stärker an Planungsverfahren beteiligt zu werden. Ebenso geht es um ein wachsendes Verständnis von Stadtbewohner*innen als Expert*innen ihrer Nachbarschaften: Die beteiligten Stadtbewohner*innen werden so zu einer Ressource, indem sie ihr Wissen in den Planungsprozess einbringen – ein gesammeltes Nachbarschaftswissen, das ein mit den örtlichen Gegebenheiten unvertrautes Planungs- oder Architekturbüro sich allein nicht aneignen kann.